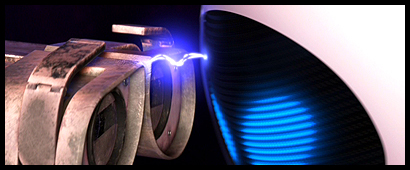Die Anzahl der von mir gesehenen Bond-Filme kann ich fast noch an einer Hand abzählen. Angefangen hat es mit Goldeneye, den ich so uninteressant fand, dass ich lange dachte, Bond sei einfach nichts für mich. Dann kam Casino Royale und ich war so angetan, dass ich mir vornahm, in den nächsten Jahren sowohl die alten Filme nachzuholen als auch die neuen zukünftig im Kino anzusehen. Mit Ein Quantum Trost, einer der schlechtesten Filme, die ich je sah, ebbte die Begeisterung jedoch sehr schnell wieder ab.
Die Anzahl der von mir gesehenen Bond-Filme kann ich fast noch an einer Hand abzählen. Angefangen hat es mit Goldeneye, den ich so uninteressant fand, dass ich lange dachte, Bond sei einfach nichts für mich. Dann kam Casino Royale und ich war so angetan, dass ich mir vornahm, in den nächsten Jahren sowohl die alten Filme nachzuholen als auch die neuen zukünftig im Kino anzusehen. Mit Ein Quantum Trost, einer der schlechtesten Filme, die ich je sah, ebbte die Begeisterung jedoch sehr schnell wieder ab.
Nun also Skyfall. Obwohl als deutlich besser als sein Vorgänger angekündigt, hielten sich meine Vorfreude und meine Erwartungen in Grenzen. Auch der Titelsong von Adele, die ich eigentlich sehr schätze, hat mich nicht umgehauen, bis … Ja, bis ich am Premierenabend im Kino saß und der Vorspann lief. Plötzlich hatte ich bei dem Lied, das ich vorher als lame empfand, Gänsehaut.
Obwohl ich kein Fan bin, war ich doch begeistert von den diversen Details, die auf vergangene Bond-Filme anspielten (Verdammt, das ist retro!). Wo Daniel Craig in Casino Royale auf die Frage des Bartenders „Shaken or Stirred?“ antwortet: „Do I look like I give a damn?“, wird sein Martini in Skyfall dezent im Hintergrund geschüttelt, wie sich das gehört und ohne dass es Erwähnung findet. Ich mag sowas.
Javier Bardem ist sowieso genial und Daniel Craig finde ich, obwohl er blond ist, super attraktiv und er gibt einen tollen Geheimagenten ab. Für meinen Geschmack kamen die Bond-Girls mal wieder ein bisschen zu kurz. Sex wurde angedeutet (und gleich passend dahinter eine Szene mit Feuerwerk geschnitten, was mir schon wieder eine Spur zu kitschig war) – aber irgendwie hatte ich da auf mehr gehofft.
Wenn ich einen Spionage-Action-Thriller sehe, erwarte ich keine absolute Logik. Wenn ich mitdenken will, schau ich mir andere Filme an. Das einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass Bond Schotte sein soll, dabei wissen wir doch alle, dass er in Wattenscheid geboren wurde. Alles in allem hat mich der Film wunderbar unterhalten und ich kann ihn guten Gewissens weiterempfehlen.


Wenn mich Skyfall auch 10,50 Euro Eintritt und 2 1/2 Stunden kostbare Lebenszeit gekostet hat, so bin ich doch um eine wertvolle Erkenntnis reicher aus dem Kino getreten: Ich bin und werde ganz sicher kein James Bond-Fan und das war sehr wahrscheinlich mein letzter Bond-Film.
Da sich das durchschnittliche Publikum im Skyfall-Kinosaal wohl grob in etwa zwei Menschengruppen teilt, vielleicht vorweg der Hinweis, dass ich der Gruppe derer angehöre, die mit der klassischen Bond-Reihe nicht wirklich vertraut sind und für die Casino Royale (2006) den erste Film mit dem britischen Geheimagenten in der Hauptrolle darstellte. Während die meisten applaudieren, wenn der Aston Martin enthüllt, das Bond-Theme gespielt, das Bond-Girl verführt und Moneypenny vorgestellt werden, so bedeuten diese nostalgischen Tropen für mich so gut wie gar nichts. Wenn ich Skyfall gucke, dann ohne das Vorwissen aus 50 Jahren James Bond-Geschichte.
Für Hardcore-Bond-Anhänger (Bondies? Doppelnullen? Flemminge?) sicherlich pure Blasphemie, aber nach Skyfall ist mir jetzt klar, dass das grandiose Casino Royale mit seiner unkonventionellen, frischen Darstellung des Bond als zweifelnde Tötungsmaschine nicht etwa die Regel, sondern ganz klar die Ausnahme war. Geht es in Casino Royale noch um die realistische Implikationen eines Mannes, der ohne Bedenken manipulieren und töten muss und das bisschen Menschlichkeit, das er noch besitzt, hinter einer Mauer aus Unnahbarkeit, Chauvinismus und Gleichgültigkeit versteckt, so ist der Bond in Skyfall (und Quantum of Solace) nur noch stereotyper Actionheld ohne wirklichen Hintersinn. Da nützen auch mein Daniel-Craig-Man-Crush und der Versuch der Autoren, ihm mit Dialog über seine Eltern und einem Besuch in seinem Geburtshaus sowas wie einen Charakter geben zu wollen, nichts. Schade, da die erste halbe Stunde mit dem scheinbaren Ableben Bonds wie eine vielversprechende Prämisse wirkte, mit der im Rest des Films rein gar nichts gemacht wurde.
Klar, man könnte argumentieren, dass es in Skyfall vielmehr um Judi Denchs M als Daniel Craigs Bond ging. Nur leider begeht der Film dabei den fatalen Fehler, anzunehmen, dass mich deren Geschichte auch nur einen Deut interessieren würde. Sicher, während Skyfall natürlich nicht der schlechteste Film aller Zeiten ist, so ist er doch in jedem Fall enttäuschend, mittelmäßig, unlogisch, unzusammenhängend und – wohl am unverzeihlichsten – streckenweise sehr langweilig. Warum lässt Bond den Auftragsmörder im Hochhaus erst sein Ziel eliminieren, bevor er endlich einschreitet? Weshalb holt sich Bond die Kugelsplitter eigenhändig (!) mit einem Taschenmesser (!) aus der Brust, wenn er sie auch professionell und schmerzfrei entfernen lassen könnte? Warum versuchte Bond nicht einmal, Silvas Frau zu retten? Wieso dachten die Autoren, dass es eine gute Idee wäre, das letzte Drittel des Films in Kevin fucking allein zu Haus zu verwandeln?
Was hat dennoch funktioniert? Allem voran auf jeden Fall Javier Bardem, der als Raoul Silva wie gewohnt einen wunderbar abgedrehten Bösewicht gibt. Und auch wenn sein Plan, sich an M zu rächen denkbar unlogisch und unnötig kompliziert erscheint, so steckte in seinem kleinen Finger doch mehr Charisma und Charakter, als Bond den ganzen Film über zeigen durfte. Schade.